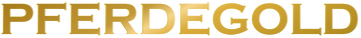Doch was tun, wenn unser Pferd krank wird? Vorbeugung und frühzeitiges Erkennen von Symptomen sind der Schlüssel zur Gesunderhaltung unserer geliebten Vierbeiner. Vielleicht fragst du dich: Welche Krankheiten treten am häufigsten auf? Und wie kann man sie rechtzeitig erkennen?
Es gibt viele Erkrankungen, die Pferde betreffen können – und das oft ganz plötzlich. Wenn dein Pferd zum Beispiel seinen Appetit verliert, an Gewicht verliert oder lahmt, können dies Hinweise auf ernsthafte Krankheiten sein. Damit wir im Ernstfall schnell reagieren können, ist es entscheidend, dass wir die häufigsten Pferdekrankheiten kennen. Mit dem richtigen Wissen und einer guten Pflege lässt sich viel verhindern oder zumindest rechtzeitig behandeln.
Gesunde Pferdehaltung beginnt bei den Basics: Eine ausgewogene Ernährung, genügend Bewegung und die Vermeidung von Stress sind essenziell. Und natürlich spielen auch die Hygiene und eine angepasste Pflege eine große Rolle. Denn nur so lassen sich viele Krankheiten bereits im Vorfeld vermeiden oder zumindest abschwächen.
Wichtige Erkenntnisse für den Pferdebesitzer:
- Kolik, Magengeschwüre und Atemwegserkrankungen gehören zu den häufigsten Pferdekrankheiten.
- Krankheiten wie Hufrehe und Strahlfäule lassen sich oft durch regelmäßige Hufpflege verhindern.
- Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen sind wichtig, um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.
- Artgerechte Haltung, gutes Futter und viel Bewegung stärken das Immunsystem des Pferdes.
- Es ist wichtig, die Anzeichen häufiger Krankheiten zu kennen, um im Ernstfall schnell handeln zu können.
Kolik: Eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung
Kolik gehört zu den am meisten gefürchteten Erkrankungen bei Pferden, und das zu Recht. Typische Anzeichen sind Unruhe, Scharren, häufiges Umschauen zum Bauch und im schlimmsten Fall das Treten gegen den Bauch. Wenn du eine Kolik bei deinem Pferd vermutest, solltest du sofort den Tierarzt kontaktieren, denn ohne schnelle Behandlung kann eine Kolik lebensbedrohlich sein.
Die Ursachen für Koliken sind vielfältig: von Fütterungsfehlern über Stress bis hin zu Darmproblemen. Am häufigsten sind Sandkoliken, Gaskoliken und Krampfkoliken. Welche Art von Kolik dein Pferd hat, bestimmt die Behandlung – und natürlich auch den Verlauf der Krankheit.
Die Prognose nach einer Kolikoperation hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Bei Dickdarmproblemen sind die Heilungschancen meist besser als bei Dünndarmproblemen.
- Je früher die Kolik behandelt wird, desto besser sind die Überlebenschancen.
- Dickdarmverdrehungen haben eine schlechtere Prognose.
- Das Alter des Pferdes ist weniger entscheidend – wichtiger ist seine allgemeine Verfassung.
Nach einer Kolikoperation ist eine längere Erholungsphase notwendig, meist über mehrere Monate. Während dieser Zeit darf dein Pferd oft nicht auf die Weide und muss streng überwacht werden, was die Fütterung und Bewegung angeht.
Vorbeugen ist hier wirklich das A und O: Eine bedarfsgerechte Fütterung, ausreichend Bewegung und Stressvermeidung senken das Kolikrisiko enorm. Achte auf qualitativ hochwertiges Raufutter, kontrolliere den Weidegang und vermeide hektische Situationen. So schützt du dein Pferd und sorgst dafür, dass Koliken möglichst gar nicht erst auftreten.
Magengeschwüre beim Pferd: Häufig, aber oft unbemerkt
Magengeschwüre sind bei Pferden häufiger, als viele glauben – und oft bleiben sie unerkannt. Besonders Sportpferde, die unter starkem Stress stehen, sind anfällig, aber auch Freizeitpferde und sogar Fohlen können betroffen sein.
Die Ursachen? Es gibt viele: falsche Fütterung, zu lange Fresspausen, zu wenig Raufutter, Stress durch Training oder Haltung. Die Symptome reichen von wiederkehrenden Koliken über Gewichtsverlust bis hin zu Verhaltensänderungen wie Unruhe oder Apathie.
Magengeschwüre lassen sich durch eine Gastroskopie diagnostizieren, bei der der Magen des Pferdes mit einer Kamera untersucht wird. Falls Geschwüre entdeckt werden, ist die Behandlung mit Magensäurehemmern wie Omeprazol die erste Wahl. Doch es ist ebenso wichtig, die Ursachen anzugehen: Mehr Raufutter, weniger Stress und angepasste Haltungsbedingungen helfen, die Heilung zu unterstützen und neuen Geschwüren vorzubeugen.
Du solltest also immer ein Auge darauf haben, ob dein Pferd Veränderungen im Verhalten zeigt. Vor allem bei Leistungspferden ist es wichtig, Fressgewohnheiten und Stresslevel im Blick zu behalten.
Atemwegserkrankungen: Vom Husten bis zum equinen Asthma
Atemwegserkrankungen sind eine der häufigsten gesundheitlichen Probleme bei Pferden. Ein einfaches Husten kann viele Ursachen haben, von viralen Infektionen wie der Pferdeinfluenza bis hin zu chronischen Erkrankungen wie dem equinen Asthma (ehemals als Dämpfigkeit bekannt).
Akuter Husten entsteht oft durch eine Infektion, etwa durch Viren wie Influenza oder Herpes. Wenn dein Pferd hustet und gleichzeitig Symptome wie Nasenausfluss, Fieber oder Mattigkeit zeigt, ist das ein Zeichen dafür, dass es sich um einen akuten Infekt handelt.
Chronischer Husten hingegen kann durch Allergien, Staubbelastung oder Schimmel im Heu verursacht werden. Pferde, die an chronischem Asthma leiden, zeigen Symptome wie erschwerte Atmung, Husten und Leistungsabfall, ohne jedoch Fieber zu haben.
Die Behandlung variiert je nach Ursache. Von Schleimlösern über Inhalationen bis hin zu Kortisonpräparaten gibt es viele Möglichkeiten, deinem Pferd zu helfen. Besonders wichtig ist aber, dass du die Haltungsbedingungen anpasst: Staubfreies Heu, frische Luft und ausreichend Bewegung können schon viel bewirken.

Huferkrankungen: Von Hufrehe bis Strahlfäule
Die Gesundheit der Hufe ist bei Pferden entscheidend, denn gesunde Hufe tragen das Pferd und ermöglichen ihm Bewegung ohne Schmerzen. Zu den häufigsten Huferkrankungen zählen Hufrehe, Hufgeschwüre und Strahlfäule.
Hufrehe ist eine Entzündung der Huflederhaut, die sehr schmerzhaft ist und oft durch Stoffwechselprobleme, falsche Fütterung oder Überbelastung ausgelöst wird. Ein Pferd, das an Hufrehe leidet, zeigt oft eine charakteristische „Entlastungshaltung“ und hat starke Schmerzen beim Laufen.
Strahlfäule ist eine bakterielle Infektion, die den Strahl des Hufes befällt und in der Regel durch schlechte Huf- oder Stallhygiene begünstigt wird. Regelmäßige Hufpflege und saubere Einstreu helfen, Strahlfäule zu verhindern.
Um die Hufgesundheit zu unterstützen, ist es wichtig, dass dein Pferd regelmäßig die Hufpflege bekommt, die es braucht. Ein erfahrener Hufschmied kann dabei helfen, Probleme früh zu erkennen und zu behandeln.
Muskel- und Skeletterkrankungen: Wenn das Pferd lahmt
Lahmheiten bei Pferden können viele Ursachen haben: von akuten Verletzungen bis hin zu chronischen Erkrankungen wie Kissing Spines. Auch Überlastung, unpassende Ausrüstung oder Fehlstellungen können zu Verspannungen und Schmerzen führen.
Wenn dein Pferd lahmt, ist eine gründliche Untersuchung durch einen Tierarzt unerlässlich. Schmerzmittel können akute Schmerzen lindern, aber langfristig ist es wichtig, die Ursache der Lahmheit zu behandeln. Physiotherapie, Osteopathie und angepasste Trainingsprogramme können helfen, Verspannungen zu lösen und das Pferd wieder beweglich zu machen.
Um solche Probleme zu vermeiden, solltest du darauf achten, dass dein Pferd immer optimal ausgerüstet ist – das gilt besonders für Sattel und Zaumzeug.
Prävention ist der Schlüssel zur Pferdegesundheit
Als Pferdebesitzer tragen wir die Verantwortung, unsere Pferde bestmöglich zu schützen und Krankheiten vorzubeugen. Ob Koliken, Hufprobleme oder Atemwegserkrankungen – viele gesundheitliche Probleme lassen sich durch gute Pflege, artgerechte Haltung und eine aufmerksame Beobachtung vermeiden oder zumindest in einem frühen Stadium erkennen.
Regelmäßige Gesundheitschecks beim Tierarzt, die richtige Fütterung und eine stressarme Haltung sind dabei essenziell. Indem wir unser Pferd genau kennen und auf Veränderungen achten, können wir viel für seine Gesundheit tun und ihm ein langes, glückliches Leben ermöglichen.
Also, schau genau hin, achte auf die kleinen Zeichen und sorge dafür, dass dein Pferd in jeder Situation gut versorgt ist.